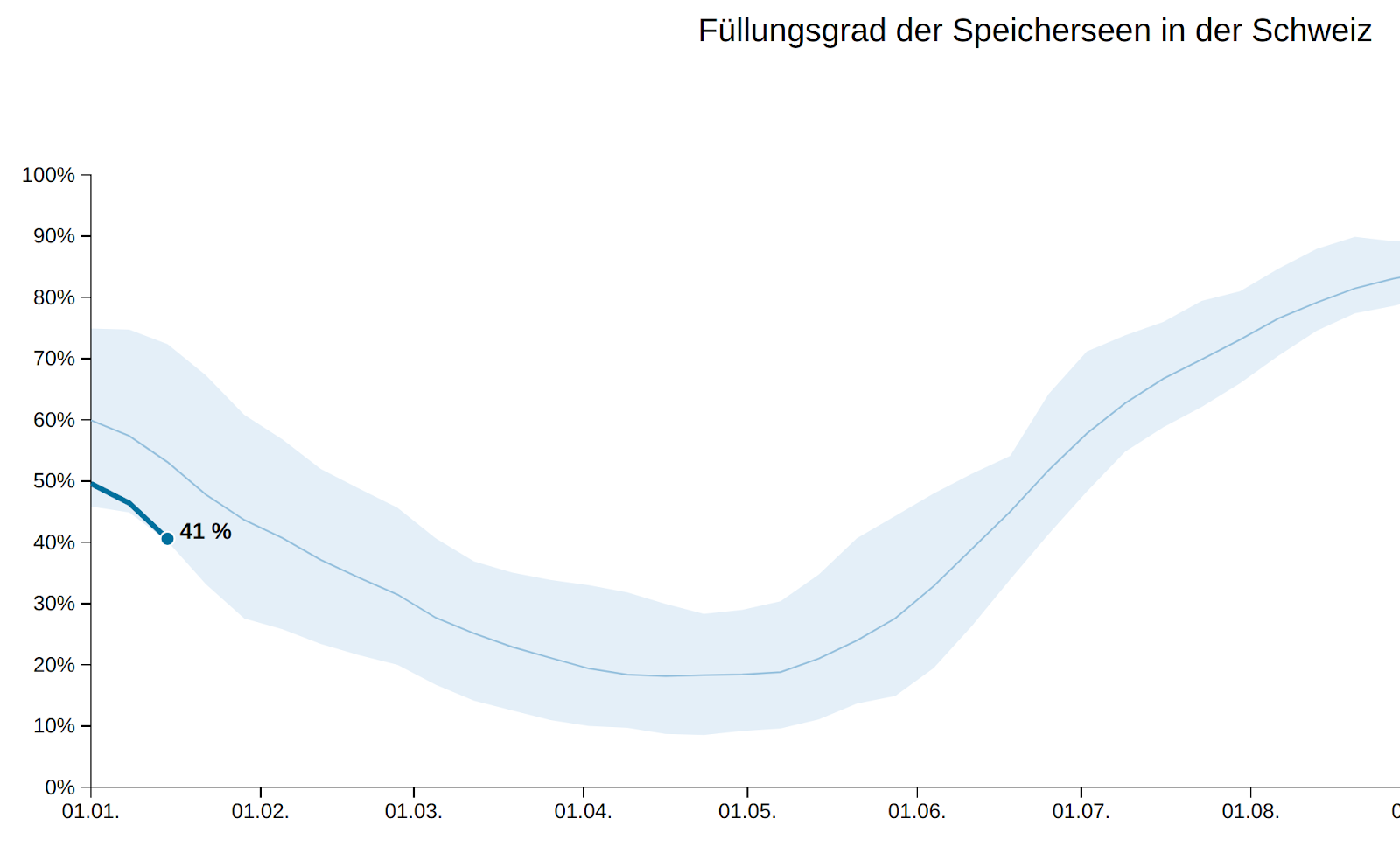https://anti-spiegel.ru/2025/wer-ist-eigentlich-die-radikal-anti-russische-kaja-kallas/
EU-Chef-"Diplomatin"
Wer ist eigentlich die radikal anti-russische Kaja Kallas?
Die ehemalige estnische Ministerpräsidentin und heutige Chefin der EU-Außenpolitik Kaja Kallas ist eine der radikalsten Anti-Russen in der EU. Interessant ist ihre Geschichte, denn ihre Familie gehörte zur regierenden Elite in der Sowjetunion und hat nach der Wende einfach die Fahne in den neuen Wind gehängt.
von Anti-Spiegel
28. Januar 2025 08:00 Uhr
Wenn Kaja Kallas in den letzten Jahren durch etwas aufgefallen ist, dann vor allem durch ihre radikal anti-russische Haltung und die Horrorgeschichten, die sie westlichen Medien gerne über das Leid erzählt, das ihre Familie in der Zeit der Sowjetunion angeblich durchleben musste. Schon daran sieht man allerdings, dass die Dame es mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt, was sie mit ihrer neuen Chefin, der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, gemeinsam hat.
Die „schlimmen Jahre“ in der Sowjetunion
Frau Kallas erzählt gerne von dem schrecklichen Leben, das ihre Familie angeblich unter sowjetischer Herrschaft erdulden musste.
Allerdings gehörte ihre Familie zur politischen Elite der estnischen Sowjetrepublik, Frau Kallas wurde für sowjetische Verhältnisse mit einem goldenen Löffel im Mund geboren, ihre Familie gehörte zur „Nomenklatura“, wie man damals sagte.
Ihr Vater Siim Kallas trat 1972 im Alter von 23 Jahren in die Kommunistische Partei ein und machte im Finanzministerium der Estnischen Sowjetrepublik Karriere. 1979, im Alter von gerade mal 31 Jahren, war er bereits Direktor des Vorstands der Estnischen Sberbank, also der staatlichen Bank. In der sowjetischen Verwaltungshierarchie entsprach das der Position eines stellvertretenden Ministers in der Regierung der Estnischen Sowjetrepublik und war mit einem hohen sozialen Status, einem Dienstwagen, einer Datscha, einer schönen Wohnung, einem angemessenen Gehalt und Zugang zu „exotischen“ Waren verbunden, die den Normalsterblichen meist verwehrt blieben.
Die 1977 geborene Kaja Kallas wuchs in ihrer Kindheit also mit Vergünstigungen auf, von denen ihre Altersgenossen nicht einmal träumen konnten.
Ihr Papa, der Genosse Siim Kallas, machte in der von Kaja heute als „imperiale“ Macht bezeichneten Sowjetunion eine Parteikarriere und wurde 1986 stellvertretender Herausgeber der estnischen Parteizeitung Rahva Hääl („Stimme des Volkes“) und 1989 Vorsitzender der Gewerkschaftsorganisationen Sowjetestlands.
Kaja Kallas versucht möglichst, diese Teile ihrer Biografie vergessen zu machen und spricht lieber darüber, wie hart es für sie war, „unter dem Joch der sowjetischen Tyrannei“ zu leben.
Die Wendehals-Familie
Ihr Vater, der eben noch überzeugte Sowjet-Kommunist, erkannte nach dem Ende der Sowjetunion die Zeichen der Zeit und hängte seine Fahne in den neuen Wind.
Von 1991 bis 1995 war Kallas Präsident der estnischen Nationalbank, gründete die Estnische Reformpartei, war von 1995 bis 1996 Außenminister, von 1999 bis 2002 Finanzminister und wurde von 2002 bis 2003 sogar estnischer Ministerpräsident.
Töchterchen Kaja wuchs also weiterhin in Wohlstand und mit Privilegien auf, denn Papa Kallas, der Ex-Kommunist, blieb auch im nun kapitalistischen und stramm anti-russischen Estland Teil der Regierungselite.
Am 1. Mai 2004 wechselte Papa Kallas zur EU und wurde EU-Kommissar für Wirtschaft und Währungsangelegenheiten. In der folgenden EU-Kommission, vom 18. November 2004 bis 9. Februar 2010 im Amt, war er Kommissar für Verwaltung, Audit und Betrugsbekämpfung, und in der darauf folgenden EU-Kommission war er ab 2010 Kommissar für Verkehr.
Nach seiner Rückkehr nach Estland wurde er wieder Abgeordneter und stellvertretender Parlamentspräsident, bevor er sich 2024 aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurückzog.
Die Tochter mit dem goldenen Löffel
Kaja Kallas schrieb, noch als Pionierin zu Sowjetzeiten, in einem ihrer Schulaufsätze, sie „möchte wie die sowjetischen Pionierhelden sein, zum Beispiel Marat Kazei, Lenja Golikow, Valya Kotik und Volodja Dubinin“. Das waren sowjetische Partisanen, die gegen die Nazis gekämpft hatten.
Aber auch Kaja passte ihre Einstellungen nach dem Zerfall der Sowjetunion den neuen Realitäten an. Als Ministerpräsidentin Estlands setzte sie für die Auslöschung der russischen Kultur, die Vertreibung russischsprachiger Menschen, der sogenannten „Nichtbürger“, die es in allen baltischen Staaten gibt, und die Zerstörung von Denkmälern aus der Sowjetzeit ein, und in dem von ihr regierten Estland wird die Waffen-SS in Museen geehrt, obwohl die Waffen-SS in Estland schlimm gewütet hat, denn den Krieg haben in Estland weniger als ein Dutzend Juden überlebt. Das hinderte die Kallas aber nicht daran, 2023 Feierlichkeiten zum Sieg über die Nazis zu verbieten.
Aber bleiben wir bei Kajas Lebenslauf.
Von 1995 bis 1999 studierte Kaja Kallas Rechtswissenschaft an der Universität Tartu und wurde 1999 in die estnische Rechtsanwaltskammer aufgenommen. Daneben wurde sie ab 2003, also im zarten Alter von gerade mal 26 Jahren und während ihr Herr Papa estnischer Ministerpräsident und dann EU-Kommissar war, Mitglied in den Vorständen und Aufsichtsräten zahlreicher estnischer Unternehmen, die sich mit erneuerbaren Energien beschäftigen.
2010 trat Kaja der von ihrem Herrn Papa gegründeten Estnischen Reformpartei bei und wurde 2011 ins estnische Parlament gewählt. 2014 wurde sie ins EU-Parlament gewählt, wo sie sicher von den Verbindungen des Herrn Papa profitierte, der damals EU-Kommissar war.
2018 wurde sie Parteichefin der von ihrem Vater gegründeten Estnischen Reformpartei, ging zurück nach Estland und gewann Anfang 2019 die Wahlen. Danach wurde sie estnische Ministerpräsidentin.
Prinzipientreue? Fehlanzeige…
Ihr wohl wichtigstes Markenzeichen ist ihre radial anti-russische Rhetorik und vor allem nach der Eskalation in der Ukraine war sie in der EU eine der lautesten Befürworterinnen immer härterer Russland-Sanktionen. Allerdings kam im Sommer 2023 heraus, dass sie privat von Geschäften mit Russland profitiert hat.
Ihr Mann Arvo Hallik war Miteigentümer und Finanzvorstand der Firma Stark Logistics, einem Unternehmen, das Transportdienstleistungen von Estland nach Russland erbracht hat, und zwar auch nach der Einführung der Sanktionen, die seine Frau am lautesten gefordert hat. Als das herauskam trat er aus der Firma aus, entschuldigte sich für den Schaden, den seine Tätigkeit seiner Frau zugefügt hat, und betonte, dass Kaja Kallas „nichts von seinen Aktivitäten wusste“.
Das dürfte allerdings gelogen gewesen sein, denn nur wenige Tage später meldeten estnische Medien, dass Kaja Kallas ihrem Ehemann im Jahr 2022, also nach der Eskalation in der Ukraine, ein Darlehen gewährt hat, von dem ein Teil zur Finanzierung des Unternehmens Stark Warehousing verwendet wurde, das Lagerdienstleistungen in Russland anbietet. Das Darlehen belief auf 350.000 Euro und wurde dem Beratungsunternehmen Novaria Consult zugewiesen, das ebenfalls im Besitz von Kallas‘ Ehemann war. Die Firma hielt ihrerseits 25 Prozent des Kapitals von Stark Logistics und 30 Prozent des Kapitals von Stark Warehousing, das sich auf das Lagergeschäft in Russland spezialisiert hatte.
Hallik bestätigte auf Anfrage der Medien, dass er die von seiner Frau erhaltenen Gelder für „finanzielle Investitionen“ in Novaria Consult verwendet hat, unter anderem „um Stark Warehousing zu starten“. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass der Inhalt dieser Investitionen angeblich „nie zwischen ihnen besprochen“ wurde.
Das erinnert mich irgendwie an die Familie Biden, denn auch Joe Biden hat schließlich immer behauptet, nie mit seinem Sohn Hunter, der immer von den beruflichen Kontakten seines Vaters profitiert hat, über dessen Geschäfte gesprochen zu haben. Kallas und Biden haben gemeinsam, dass die westlichen Medien ihnen das glauben und keine lästigen Fragen stellen.
Schwestern im Geiste
Kallas hat also durchaus viel mit ihrer neuen Chefin Ursula von der Leyen gemeinsam, die ebenfalls durch Korruptionsskandale aufgefallen ist. Es sei nur an die Bestellung der Impfdosen von Pfizer erinnert, was natürlich kein Nachspiel hat, denn gerade erst hat ein Gericht das Verfahren deswegen eingestellt.
Und auch bei von der Leyen betrifft einer ihrer Skandale ihren Ehemann. Heiko von der Leyen ist Medizinischer Direktor bei der Pharma-Firma Orgenesis, die sich auf die Entwicklung von Zell- und Gentherapien spezialisiert hat. Dazu gehört auch die mRNA-Technologie, die von der EU-Kommission im Zuge der Covid-Panik salonfähig gemacht wurde.
Zur Erinnerung: Die mRNA-Technologie wurde schon 1990 entdeckt und die Pharma-Industrie hat danach 30 Jahre lang erfolglos versucht, Medikamente mit dieser Technologie zuzulassen, weil die Nebenwirkungen nicht absehbar sind. Diese Technologie wurde dann im Zuge der Pandemie durchgepeitscht, und wegen einer Krankheit, an der kaum ein Prozent der Infizierten stirbt, wurden Milliarden Menschen mit einer experimentellen Gentherapie „geimpft“, denn die Covid-Impfstoffe von Pfizer sind per Definition eine Gentherapie.
Aber bei Ursula von der Leyen ist es wie bei Joe Biden und Kaja Kallas: Die westlichen Medien stellen dazu keine Fragen.
Eine lustige Verschwörungstheorie zum Schluss
Unterhaltsam ist, dass es die Verschwörungstheorie gibt, dass Kallas in Wahrheit für russische Geheimdienste arbeitet. Ich halte das für Unsinn, aber ich finde die Geschichte unterhaltsam genug, um diesen Artikel damit abzuschließen.
Kallas hat an der Universität von Tartu studiert, deren Studenten immer im Fokus des sowjetischen KGB und danach des russischen FSB standen, um interessante Kandidaten anzuwerben. Nach ihrem Abschluss arbeitete Kaja Kallas einige Zeit für die Anwaltskanzlei Hannes Snellmann in Helsinki. Finnland war für russische Geheimdienste früher eine wichtige Basis für Operationen im Baltikum und in nordeuropäischen Ländern.
Die unterhaltsame Verschwörungstheorie besagt, dass Kallas als Studentin und/oder während ihrer Arbeit für die finnische Anwaltskanzlei von russischen Geheimdiensten angeworben wurde. Die Russlandgeschäfte ihres Mannes wären demnach der Kanal gewesen, über den Kallas für ihre Arbeit entlohnt wurde.
Ihre Aufgabe wäre es demnach, Europa wirtschaftlich zu schaden und es zu schwächen. Und das – das muss man ganz objektiv festhalten – tut sie mit den Russland-Sanktionen, deren eifrigste Befürworterin Kallas ist, ausgezeichnet. Und indem sie sich für immer neue Waffenlieferungen und Finanzhilfen an die Ukraine einsetzt, schwächt Kaja Kallas die EU zwangsläufig militärisch und finanziell.
Auch wenn diese Verschwörungstheorie unterhaltsam ist, halte ich sie für Blödsinn, denn das russische Interesse ist nicht die Schwächung Europas. Das russische Interesse ist es, den Einfluss der USA aus Europa zu verdrängen und mit Europa zusammenzuarbeiten. Und dazu braucht es ein starkes Europa, das stark genug ist, den USA Widerworte zu geben und eine Politik der eigenen Interessen zu verfolgen, während ein schwaches Europa sich nie aus dem neokolonialen Diktat der USA befreien kann.